Lehre als
Kraftfahrzeugtechniker/in (HM PKW)
Autos sind deine Leidenschaft? Als PersonenkraftwagentechnikerIn tüftelst du tagtäglich an Motor, Fahrwerk und Co. und sorgst dafür, dass jedes Auto wieder voll funktionstüchtig auf die Straße starten kann.
Kurzbeschreibung
Die Ausbildung zum/zur Personenkraftwagentechniker*in erfolgt im Modullehrberuf Kraftfahrzeugtechnik im Hauptmodul Personenkraftwagentechnik.
Kraftfahrzeugtechniker*innen im Hauptmodul Personenkraftwagentechnik arbeiten in Kfz-Werkstätten, wo sie Wartungs- und Reparaturarbeiten an Personenkraftwagen durchführen. Sie warten, reparieren und montieren mechanische, elektrische und elektronische Bauteile, wie z. B. Motoren, Fahrwerk, Beleuchtungs-, Zünd- und Starteranlagen oder Alarmanlagen. Sie bauen schadhafte und unbrauchbar gewordene Teile aus und ersetzen diese durch neue. Sie nehmen Einstellungen am Motor, an den Bremsen, an der Lenkung oder an der Lichtanlage vor und führen das für Personenkraftfahrzeuge vorgeschriebenen Service bzw. die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- und Umweltüberprüfung („Pickerlprüfung“) durch.
Personenkraftwagentechniker*innen beraten und informieren ihre Kundinnen und Kunden über die erforderlichen Reparaturen und Servicearbeiten. Sie arbeiten eigenständig sowie im Team mit Vorgesetzten und Berufskolleg*innen.
Tätigkeiten
- technische Unterlagen (Baupläne, Schaltpläne etc.) lesen und interpretieren
- Schäden an Personenkraftfahrzeugen durch Überprüfen der wichtigsten Teile und Komponenten (Fahrgestell, Motor, Karosserie) mit Hilfe mechanischer, elektrischer und elektronischer Mess- und Prüfverfahren feststellen, Fehlerdiagnosen durchführen
- Materialien, Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen und beschaffen
- Bauteile des Fahrwerkes (z. B. Karosserie, Radaufhängung, Lenkung, Bremsen, Räder) prüfen, ausbauen, montieren und warten
- Reparaturarbeiten an mechanischen, elektromechanischen und elektrischen Teilen des Fahrzeuges durchführen
- Teile, die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind (z. B. Zündkerzen, Luftfilter) austauschen
- Werkstoffe wie Metallteile, Bleche und Kunststoffteile bearbeiten: Messen, Feilen, Sägen, Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden, Schweißen, Schleifen und Trennschleifen
- elektrische und elektronische Einrichtungen wie z. B. Heiz- und Klimaanlagen, Entertainment-Center, Navigationssysteme, Freisprechanlagen und Alarmanlagen einbauen, warten und reparieren
- Servicearbeiten wie „Pickerlprüfung“ durchführen: Motor, Bremsen, Lichtanlagen, Abgaswerte etc. an entsprechenden Prüfständen und mit verschiedenen Messgeräten kontrollieren, Ergebnisse dokumentieren
- mit entsprechender Spezialausbildung: Prüf-, Service- und Reparaturarbeiten an Alternativantrieben (z. B. Elektromotoren, Hybridantriebe, Brennstoffzellenantrieben) durchführen
- Kühl- und Schmiermittel und andere Flüssigkeiten prüfen und tauschen
- Kundinnen und Kunden über die Handhabung und Wartung der Fahrzeuge beraten und informieren
- Arbeitsprotokolle, Wartungs- und Serviceprotokolle, Kundenkarteien führen
So viel wirst du in etwa verdienen
800-900
1. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.000-1.090
2. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.300-1.425
3. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
1.750-1.870
4. Lehrjahr
laut Kollektivvertrag
Anforderungen
In jedem Beruf brauchst du ganz spezielles fachlisches Know-how, das in der Aus- und Weiterbildung vermittelt wird. In den beiden Menüpunkten Ausbildung und Weiterbildung findest du Informationen, welche fachlichen Kompetenzen in diesem Beruf besonders wichtig sind.
Es gibt auch Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften die in allen Berufen wichtig sind. Dazu gehören besonders:
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
- genaues und sorgfältiges Arbeiten
- selbstständiges Arbeiten
- Einsatzfreude
- Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit und Bereitschaft mit anderen zusammen zu arbeiten (Teamfähigkeit)
- Lernbereitschaft
Die folgende Liste gibt dir einen Überblick über weitere allgemeine Anforderungen, die in DIESEM Beruf häufig gestellt werden. Diese können natürlich von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich sein.
DENK DARAN: Viele dieser Anforderungen sind auch Bestandteil der Ausbildung.
Körperliche Anforderungen: Welche körperlichen Eigenschaften sind wichtig?
- Auge-Hand-Koordination
- Fingerfertigkeit
- gute körperliche Verfassung
Sachkompetenz: Welche Fähigkeiten und Kenntnisse werden von mir erwartet?
- Anwendung und Bedienung digitaler Tools
- gute Beobachtungsgabe
- handwerkliche Geschicklichkeit
- räumliches Vorstellungsvermögen
- technisches Verständnis
- Zahlenverständnis und Rechnen
Sozialkompetenz: Was brauche ich im Umgang mit anderen?
- Aufgeschlossenheit
- Hilfsbereitschaft
- Kommunikationsfähigkeit
- Kund*innenorientierung
Selbstkompetenz: Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen?
- Aufmerksamkeit
- Beurteilungsvermögen / Entscheidungsfähigkeit
- Flexibilität / Veränderungsbereitschaft
- Freundlichkeit
- Sicherheitsbewusstsein
- Umweltbewusstsein
Methodenkompetenz: Welche Arbeits- und Denkweisen sind wichtig?
- Kreativität
- logisch-analytisches Denken / Kombinationsfähigkeit
- Problemlösungsfähigkeit
- systematische Arbeitsweise
Berufsschulen
Ihre aktuellen Einstellungen bei den Cookie Präferenzen erlauben es nicht, die Karte zu laden. Wenn Sie die Karte sehen wollen, bitte akzeptieren Sie die funktionellen Cookies in Ihren .
Landesberufsschule Bludenz
Unterfeldstraße 27
6700 Bludenz
Landesberufsschule Bregenz 2
Feldweg 25
6900 Bregenz
FAQs
Wie lange geht meine Lehrausbildung?
Die Dauer deiner Lehrausbildung kann zwischen zwei und vier Jahre liegen. Das kommt auf deinen Lehrberuf an. Unter dem Menüpunkt „Lehrberufe“ findest du alle Lehrberufe, die du in Vorarlberg erlernen kannst. Bei jedem der einzelnen Lehrberufe steht auch dabei, wie lange deine Ausbildung geht.
Wie finde ich den passenden Lehrberuf?
Auf unserer Website findest du eine Auflistung aller Lehrberufe, die du in Vorarlberg erlernen kannst. Wenn du noch gar nicht weißt, welcher Lehrberuf dich besonders interessiert, dann klick dich doch Mal durch die einzelnen Lehrberufe – du wirst staunen wie viele unterschiedliche Lehrberufe es gibt. Unter der Rubrik „Termine“ findest du alle Events, Messen und Informationsveranstaltungen, die in der nächsten Zeit stattfinden. Dort vorbeizuschauen lohnt sich auf jeden Fall und hilft dir bei der Suche nach dem passenden Lehrberuf weiter.
Muss ich mich selber bei der Berufsschule anmelden?
Nein, das macht das Unternehmen für dich, bei dem du die Lehre beginnst.
Was verdiene ich in meinem Lehrberuf?
Dein Lehrlingsgehalt ist in einem Kollektivvertrag geregelt. Wenn es bei deiner Ausbildung keinen Kollektivvertrag gibt, wird die Lehrlingsentschädigung im Lehrlingsvertrag vereinbart. In jedem Jahr deiner Lehrzeit steigt dein Gehalt an. Unter dem Menüpunkt „Lehrberufe“ findest du bei jedem Lehrberuf dein Gehalt je nach Lehrjahr. Bitte beachte, dass dies dein Lohn, je nach Betrieb und deinem Arbeitsbereich variieren können.
Wie finde ich offene Lehrstellen?
Alle Ausbildungsbetriebe findest du unter dem Menüpunkt „Lehrbetriebe“. Hier siehst du auch gleich welche Betriebe in welchen unterschiedlichen Lehrberufen ausbilden. Du kannst dir die Websites der Betriebe anschauen, die dir gefallen und oft findest du dort auch offene Lehrstellen. Aber auch auf anderen Wegen findest du offene Lehrstellen: In den Berufsinfozentren (BIZ Bregenz, BIZ Feldkirch, BIZ Bludenz ), bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer, bei der Lehrlings- und Jugendabteilungen der Arbeiterkammer und im BIFOInformationszentrum Dornbirn kannst du dich über offenen Lehrstellen informieren. Oft findest du auch Stelleninserate in der Zeitung oder aber Familienmitglieder und Freunde wissen über offene Lehrstellen in einer Firma Bescheid. Wenn möglichst viele Personen wissen, dass du auf Lehrstellensuche bist, können sie dich bei deiner Suche unterstützen. Sollte es nicht klappen, erkundige dich beim BIFO nach der Möglichkeit des Jugendcoachings – hier hilft dir dein persönlicher Coach bei der Lehrstellensuche.
Wann kann ich eine Lehre machen?
Um eine Lehre beginnen zu können, musst du neun Jahre zur Schule gegangen sein. Somit hast du die gesetzliche Schulpflicht erfüllt und kannst dich entscheiden, ob du einen Lehrberuf erlernen oder weiterhin die Schule besuchen willst.
Arbeitsbereiche
Kraftfahrzeugtechniker*innen im Hauptmodul Personenkraftwagentechnik sind mit der Prüfung, dem Ausbau, der Montage und Reparatur von Personenkraftwagen befasst. Sie warten und reparieren einzelne Komponenten und Bauteile des Fahrwerkes (Federung, Radaufhängung, Lenkung, Bremsen, Räder, Druckluftanlagen), der Motoren und aller elektrischen und elektronischen Anlagen (wie z. B. die Stromversorgungsanlage, Starterbatterie, Lichtmaschine), dem Motormanagement (Gemischaufbereitung und Zündanlage) sowie die Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer, Rücklicht, Armaturenbrettbeleuchtung). Sie beseitigen Korrosionsschäden (Rost) und führen Blecharbeiten und Lackierungen durch.
Bevor Personenkraftwagentechniker*innen mit den Reparatur- und Servicearbeiten beginnen, suchen sie systematisch nach Störungen und Defekten. Sie finden die Ursachen von Schäden und Funktionsstörungen am Fahrzeug heraus, in dem sie mit verschiedenen mechanischen, elektrischen und elektronischen Mess- und Prüfgeräten und Vorrichtungen die wichtigsten Teile am Fahrzeug überprüfen. Dabei werden z. B. Hörkontrollen am Motor, elektronische Prüfungen und Fehlerabfragen mit Motortestgeräten und Tests der Bremsanlage am Bremsprüfstand durchgeführt.
Am Abgasmessstand werden die Schadstoffwerte der Auspuffanlage gemessen und bei Überschreiten der gesetzlich vorgegebenen Toleranzgrenze die Ursachen ermittelt und behoben (z. B. defekter Katalysator oder Lambdasonde). Mit dem Motortester werden die Einstellungen des Motors kontrolliert und der Fehlerspeicher ausgelesen. Sie führen Reifenwechsel und Ölwechsel durch und stellen Sicherheitszertifikate („Pickerl“) aus.
Je nach Spezialisierung führen Personenkraftwagentechniker*innen auch den Ein- und Ausbau von Klimaanlagen, Freisprechanlagen, Navigationssystemen, Alarmanlagen, Tempomaten, Einparkhilfen usw. durch. Sie dokumentieren ihre Arbeiten in Wartungsprotokollen und beraten und informieren ihrer Kundinnen und Kunden über die Möglichkeiten und Funktionen der Fahrzeuge, deren sichere Handhabung und Wartung und über erforderliche Reparatur- und Servicearbeiten. Mit einer entsprechenden Ausbildung im Spezialmodul „Hochvolt-Antriebe“ führen Personenkraftwagentechniker*innen Prüf-, Service- und Reparaturarbeiten auch an alternativen Antrieben durch (z. B. Elektromotoren, Hybridantriebe, Brennstoffzellenantriebe).
Arbeitsumfeld
Kraftfahrzeugtechniker*innen für Personenkraftwagen arbeiten in Werkstätten und Hallen von Kfz-Betrieben, aber auch in der Kraftfahrzeugindustrie und in verschiedensten Unternehmen mit eigenem großem Fuhrpark. Je nach Auftrag und Umfang arbeiten sie eigenständig oder im Team mit Berufskolleg*innen und anderen Fachkräften zusammen. Zu ihren Berufskolleg*innen gehören vor allem Karosseriebautechniker*innen (siehe z. B. °Karosseriebautechnik (Lehrberuf)#), Lackierer*innen (siehe °Lackiertechnik (Lehrberuf)#), Vulkaniseur*innen (siehe °Reifen- und Vulkanisationstechnik (Lehrberuf)#) aber auch Autoverkäufer*innen (siehe z. B. °Autoverkäufer*in#, °Einzelhandel – Kraftfahrzeuge und Ersatzteile (Lehrberuf)#). In Werkstätten haben Kraftfahrzeugtechniker*innen häufig Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden und mitunter zu Schadensgutachter*innen (°Kfz-Sachverständiger / Kfz-Sachverständige#).
Arbeitsmittel
Kraftfahrzeugtechniker*innen für Personenkraftwagen hantieren mit Handwerkzeugen, wie z. B. Schraubenzieher und -schlüssel, Zangen, Hämmer, Messwerkzeuge, Multimeter, Kerzenschlüssel sowie mit verschiedenen Maschinen und Vorrichtungen: Hebebühnen, Wagenheber, Wuchtmaschinen, Achsmessstand, Bremsprüfstand, Bohrmaschinen etc. Immer wichtiger werden elektronische Mess- und Prüfgeräte (z. B. Motortestgeräte, Fehlerspeicherauslesegeräte).
Bei ihrer Arbeit verwenden sie diverse Karosserieersatzteile aus Metall und Kunststoff, Hilfsmaterialien wie Kühlmittel, Lötmittel, Schmiermittel, Isoliermaterial, Batteriesäure, destilliertes Wasser, Bremsflüssigkeit, Gefrierschutzmittel und Ersatzteile, wie z. B. Starterbatterien, Generatoren, Starterersatzteile, Zündkerzen, Glühbirnen und Dichtungsringe, Kabel und Schrauben. Sie führen Betriebsbücher, Wartungsprotokolle, Material-, Lager- und Stücklisten und lesen Wartungshandbücher und Bedienungsanleitungen.
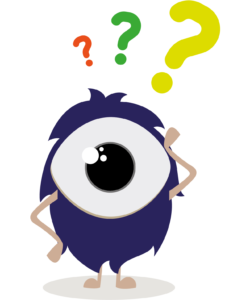
Lehre und Matura?
Vielleicht doch etwas anderes
Installations- und Gebäudetechnik (Modul)
Was gehört unbedingt in eine Wohnung? Eine funktionierende Heizung und ein Wasserhahn. Als Installations- und GebäudetechnikerIn sorgst du dafür, dass solche Einrichtungen in jeder Wohnung zu finden sind.
Karosseriebautechniker/in
Passiert ein Unfall, kommst du als KarosserietechnikerIn ins Spiel: Du reparierst beschädigte Autoteile und bringst das Fahrzeug wieder auf Vordermann. In so einer Unglückssituation bist du ein wahrer Reperaturheld!
Maler/In und Beschichtungstechniker/in – Funktionsbeschichtungen
Egal ob Holz, Metall, Beton oder Kunststoff: Maler- und BeschichtungstechnikerInnen verpassen zahlreichen Materialien einen neuen Look.
Oberflächentechnik – Feuerverzinkung
Metallteile wie Rohre oder Stangen in flüssiges Zink tauchen – hört sich spannend an? Ist es auch. In deinem Lehrberuf als OberflächentechnikerIn im Bereich der Feuerverzinkung spielst du wortwörtlich mit dem Feuer!
Textilreiniger/in
Kleider machen Leute - aber nur, wenn sie auch in tiptop Zustand sind. Mit dieser Ausbildung wirst du zum/r MeisterIn aller Stoffe!
Tischler/in
Vom Bett, über den Stuhl und den Kasten würdest du am liebsten alles selber machen? Dann bist du in einer Lehre zum/zur TischlerIn bestens aufgehoben.
